Die Grönenberg-Burg und ihre Burgmannshöfe
Im Umkreis der Grönenbergburg in Melle im heutigen Grönenbergpark lagen eine ganze Reihe von Burgmannshöfen. Der Bischof als Eigentümer dieser großen Burganlage, heute ist an dieser Stelle noch ein kleiner Hügel im Grönenbergpark zu sehen, verlieh auf Lebenszeit an Ritter Güter und Einkünfte. Verschiedene schriftliche Quellen weisen darauf hin, dass der Hügel im Park neben dem Heimathof aus den Materialien der alten Burg bestehen soll.
F. Schulhof geht in der 1908 verfassten Schrift: Beiträge zur Heimatkunde des Regierungsbezirkes Osnabrück, herausgegeben vom Lehrerverein der Diözese Osnabrück in Heft 2 genauer auf die alte Burg ein. So schreibt er, dass struppige Eichen und niedriges Gebüsch den Grönenberg weithin kenntlich machen.

Diese Skizze ließ F. Schulhof um 1900 vom Oberpostassistenten H. Sprehe anfertigen. Sie zeigt die struppigen Eichen und das niedrige Gebüsch auf und am Burghügel im heutigen Grönenbergpark.
Die alte Burg wird 1250 ersterwähnt, 1225 hatte Bischof Engelbert den Grönegau schon in Besitz genommen. Bischof Konrad von Rietberg veräußerte 1285 die Anlagen, der Koadjutor (ein vom Pabst ernannter Bischof zur Mithilfe) Diedrich von der Mark löste sie dann wieder ein und ließ an gleicher Stelle eine neue Burg neben einem festen Turm aufbauen. Bischof Melchior von Grubenhagen verpfändete für eine Kreditsicherung um 1350 den Grönenberg und 20 Burgmänner. Als 1390 Bischof Diedrich von Horn vom Grönenberg nach Melle ritt, wurde er von Alhard von dem Bussche überfallen und gefangen genommen.
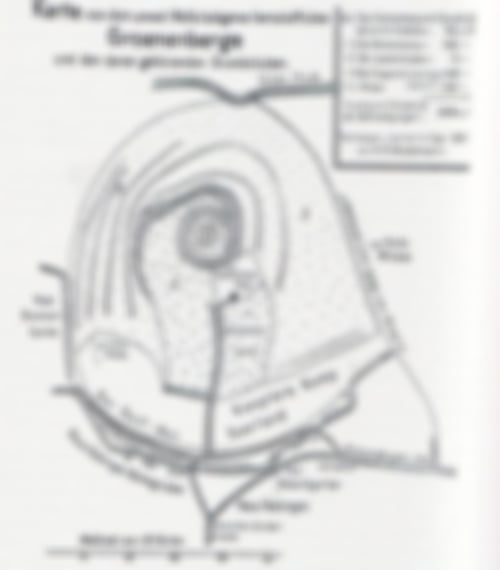
Diese Zeichnung aus dem Jahre 1801 wurde von H. R. Brockmann, einem anerkannten Fachmann, erstellt. Da es zu der Zeit die baulichen Anlagen auch schon nicht mehr gab, muss er im Gelände noch einiges vorgefunden haben, was ihn bewegte, es in dieser vermessenen Struktur darzustellen. Diese innere Anlage deckt sich mit der am Ende des Berichtes gezeichneten Anlage mit einem größeren Umfeld.
Bischof Otto von Hoya befestigte um 1415 den Grönenberg noch mehr und baute die befestigte Anlage noch weiter aus. Von 1454 bis 1551 befand sich die gesamte Anlage im Pfandbesitz (rechtlich gegebene Übergabe an den Gläubiger) der Ritter von dem Bussche zu Gesmold.
Nach 1556 war der Grönegau für längere Zeit den in Iburg wohnenden Drosten unterstellt, der Grönenberg verlor sein Ansehen als Landesburg. Die Anlagen verkamen, unter Bischof Heinrich III von Sachsen (1550-1585) wurden die Gebäude abgerissen. Der Turm blieb stehen und diente den Mellern als Gefängnis. Die letzten Insassen, drei Schwerverbrecher, wurden 1771 auf dem Galgenkamp hingerichtet. Anschließend verfiel der Turm und wurde niedergerissen.
Doch nun zurück zu den alten Zeiten, als die Grönenbergburg noch seine Berechtigung hatte. Die Nutznießer der Anlagen mussten für ihre Berechtigungen abwechselnd die Landesburg bewachen und verteidigen. Aus diesem Bund wuchs dann ein Zusammenschluss, der Burgmannsbund, zusammen. Ihre Burgmannsgüter oder auch Höfe lagen teilweise innerhalb der weiteren Burgbefestigung aber auch in einem etwas größeren Abstand. Alljährlich trafen sich die Burgmänner mit dem jeweiligen Osnabrücker Bischof am Martinstag, den 11. November, um gemeinsam den Burgmannswein zu trinken. Er wurde aus der Amtskasse bezahlt.
Fast alle Meller Historiker haben sich damit beschäftigt, welche der vielen großen und kleinen Adelssitze in Melle zu den Burgmannshäusern gehörten. Zu den größeren Häusern gehörten das Haus Drantum. Die Namensdeutung ist sehr unterschiedlich, eine Deutung ist „Dran“ wie nahe und „thum“ wie Eigentum, somit nahes Eigentum. Da es aber angeblich schon 1236 erwähnt wird, stand die Anlage Drantum schon vor dem Bau der Grönenbergburg. Dann wäre es vom Ursprung her kein Burgmannshof. Auch nicht weit entfernt liegt das Haus Rabingen, sicherlich ein Burgmannshof. Es wird um 1350 erstmals erwähnt. Haus Walle an der westlichen Stadtgrenze scheint auch älter als die Landesburg zu sein, wobei es hier wenig verlässliche ältere Zahlen gibt. Die Anlage Schmalenau, am Standort des heutigen Wasserwerkes, wird ein Burgmannshof gewesen sein. Zu diesen Anlagen, die den Schutz des Bischofs zu gewährleisten hatten, zählten auch die Buxburg und Haus Wohnunge im heutigen Bakum, gelegen am heutigen Gewerbegebiet Bakum.
Im unmittelbaren Bereich der Grönenbergburg lag auf jeden Fall der Gesmolder Burgmannshof. Er lag unweit des heutigen Minigolfplatzes, die Reste wurden in den 60er Jahren abgebrochen. Auch lag hier im Bereich der alten Befestigungsanlagen der Vinckesche Burgmannshof, der schon 1350 erwähnt wird. Dietrich von Ledebur verpflichtete sich auch 1350 zur Burgverteidigung, belehnt mit einem Burgmannshof.
Weitere Burglehen mit wohl kleineren Höfen: Das Palsterkamper Burglehen, das Drantumer Burglehen, das unabhängig vom Gut Dratum gewesen zu sein scheint, das Brucher Burglehen, das Kerßenbrocker Burglehen, das Reckenberger Burglehen. Einige noch heute bestehende Höfe sind aus solchen Burgmannshäusern hervorgegangen bzw. haben bei der Verteidigung der Landesburg mitgewirkt. Es sind: Borgmeier in Hustädte, Kemna in Warringhof, Broxten in Wennigsen und Vinkemühlen in Insingdorf.
Insgesamt sollen 15 oder 16 Meller Burgmannshäuser mit Verteidigungsaufgaben der Landesburg des Bischofs verpflichtet worden sein.

Diese Karte zeigt das erweiterte Gelände um die Grönenbergburg. Besonders deutlich zeigt sich im Norden die Else, die sich im alten Flussbett windet. Dadurch hatte sie sicherlich die doppelte Länge, die Fließgeschwindigkeit ist dadurch deutlich reduziert. Das ärgerte die Mühlenbetreiber, so auch die Betreiber der Meller Mühle an der Mühlenstraße. Hier kann man nachvollziehen, dass sie den geraden Verlauf des Flusses, wie er sich heute darstellt, gerne haben wollten. Da die Mühlen oft landesherrliche Bauten waren, brauchte man die Abhängigen ja nur an die Arbeit mit Schaufel und Loren schicken. Der Laer Mühlenbach, heute Laerbach, hatte damals auch noch einen anderen Verlauf. Er verlief südlich der Grönenbergburg und wird mit dafür gesorgt haben, dass die Schutzgräben immer ordentlich gefüllt sind.
Diese Karte zeigt aber auch einige adelige Anlagen im nahen Umkreis um die Grönenbergburg.
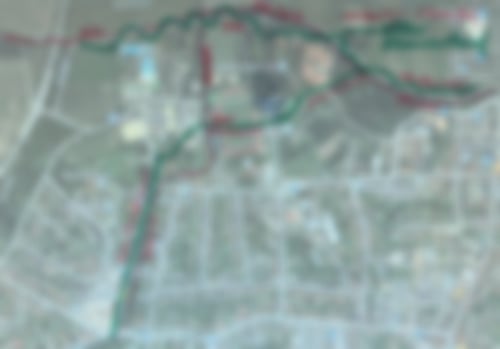
Überträgt man den alten Verlauf der Else und des Laer Mühlenbaches auf die Karte von Google Maps,so kann man sich in etwa vorstellen, wie es vor Jahrhunderten hier im Gebiet ausgesehen haben wird.
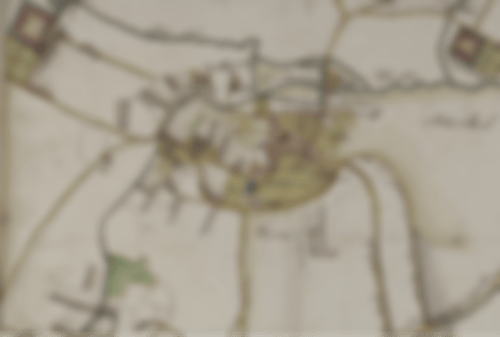
Sicherlich nicht maßstäblich aber interessant ist diese Karte aus dem Jahr 1765. Die Grönenbergburg ist schon gar nicht mehr eingetragen, der Turm ist aber noch eingezeichnet (links oberhalb des Gutes Drantum als Amtssitz des Amtes Grönenberg). Hier fällt besonders auf, dass die Else und der Laer Mühlenbach einen „sonderbaren“ Verlauf haben. Wichtig war, dass das Haus Gesmold, die Mellingsche Mühle und das Haus Brocke (Gut Bruche) eingetragen waren. Es fehlen natürlich nicht die Häuser Drantum, Schmallage und Engelgarten. Übrigens, die im Bericht aufgeführten adeligen Anlagen im Bereich des Grönenberggeländes aber auch im Grönegau finden Sie ausführlich dargestellt an anderer Stelle auf dieser Homepage.
Text + Bild: Bernd Meyer


